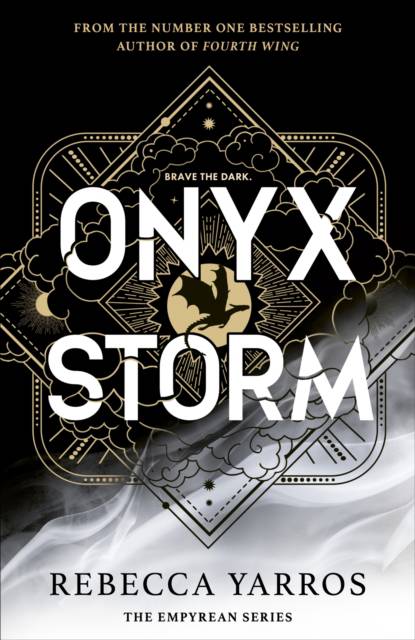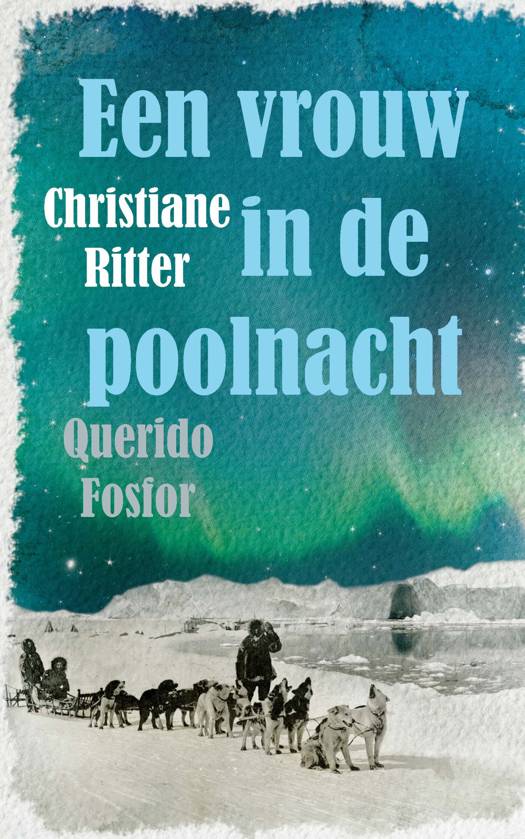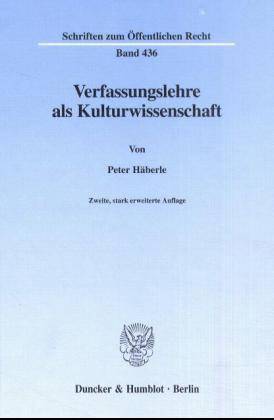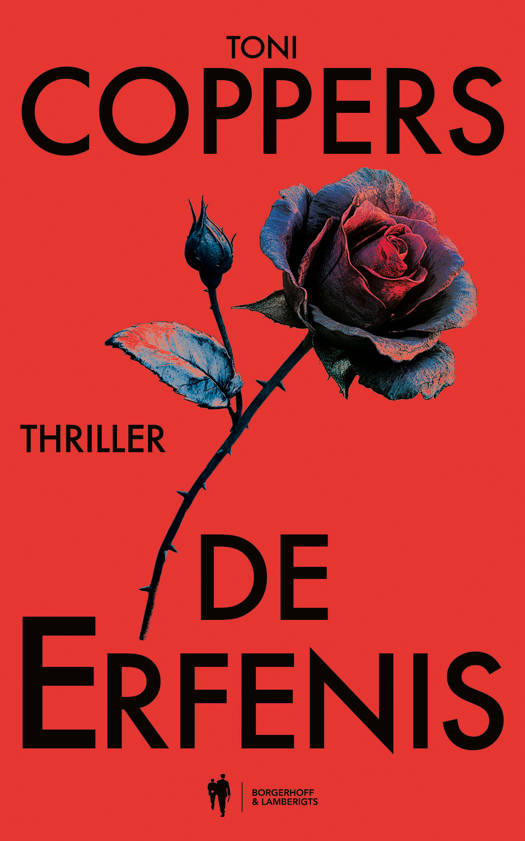
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Omschrijving
Bereits die Erstauflage der »Verfassungslehre als Kulturwissenschaft« aus dem Jahre 1982 war von einem in doppelter Hinsicht programmatischen Anspruch bestimmt: Methodisch wurde der interdisziplinäre Dialog mit den Kulturwissenschaften gesucht und damit Hand in Hand gehend ein in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht rechtsvergleichender Ansatz gewählt. Inhaltliches Ziel war es, die »Sache der Kultur« über das Kulturverfassungsrecht im engeren Sinne hinaus zu einem umfassenderen und tieferen Gegenstand einer Verfassungslehre zu machen, die weit über die Grenzen der Verfassungskultur des Grundgesetzes hinaus allgemeingültige Strukturen des »Typus« Verfassungsstaat zu erschließen vermag.
In 15 Jahre währender wissenschaftlicher Arbeit hat der Verfasser seither die zentralen Problemfelder einer kulturwissenschaftlich orientierten Verfassungslehre abgesteckt (vgl. die nachfolgende Inhaltsübersicht). Ermutigt wurde er dabei durch das positive Echo, das sein Ansatz bei ausländischen Gastprofessuren in Rom (1990 - 1997) sowie Turin (1993) und Granada (1995) erfuhr. Der kooperative Verfassungsstaat wird in entwicklungsgeschichtlicher Perspektive erschlossen, das »Möglichkeitsdenken« eröffnet die notwendigen Wege zur Verfassungspolitik. Neben den klassischen Themen von Menschenwürde und Demokratie stellt sich das Werk den neuen Herausforderungen der deutschen und europäischen Einigung, der damit verbundenen Föderalismus- und Regionalismusdiskussion, schließlich den Fragen einer fortschreitenden Internationalisierung sowie Globalisierung und wagt so - das Völkerrecht integrierend - den Schritt zu einer Verfassungslehre in »weltbürgerlicher Absicht«. Die Rechts- bzw. Verfassungsvergleichung als »fünfte« Auslegungsmethode und das Textstufenparadigma sind hier unabdingbare Voraussetzungen, den »Typus« Verfassungsstaat rechts- wie kulturwissenschaftlich zu erschließen. Dazu gehört aber auch, daß die schöne Literatur und die anderen Künste wie die Musik mit einbezogen werden.
Den »Rahmen« für die Darstellung bilden die Präambeln, Übergangs- und Schlußbestimmungen. Das gesamte Werk stützt sich auf fast weltweiten, Kleinstaaten und Entwicklungsländer einbeziehenden Vergleich von Verfassungstexten als »Primärliteratur«, da in ihnen auch Wirklichkeit, Judikatur und Wissenschaft gespeichert ist und sich nur aus dieser ineinandergreifenden Vielfalt das »Weltbild des Verfassungsstaates« als Quintessenz erkennen läßt.
In 15 Jahre währender wissenschaftlicher Arbeit hat der Verfasser seither die zentralen Problemfelder einer kulturwissenschaftlich orientierten Verfassungslehre abgesteckt (vgl. die nachfolgende Inhaltsübersicht). Ermutigt wurde er dabei durch das positive Echo, das sein Ansatz bei ausländischen Gastprofessuren in Rom (1990 - 1997) sowie Turin (1993) und Granada (1995) erfuhr. Der kooperative Verfassungsstaat wird in entwicklungsgeschichtlicher Perspektive erschlossen, das »Möglichkeitsdenken« eröffnet die notwendigen Wege zur Verfassungspolitik. Neben den klassischen Themen von Menschenwürde und Demokratie stellt sich das Werk den neuen Herausforderungen der deutschen und europäischen Einigung, der damit verbundenen Föderalismus- und Regionalismusdiskussion, schließlich den Fragen einer fortschreitenden Internationalisierung sowie Globalisierung und wagt so - das Völkerrecht integrierend - den Schritt zu einer Verfassungslehre in »weltbürgerlicher Absicht«. Die Rechts- bzw. Verfassungsvergleichung als »fünfte« Auslegungsmethode und das Textstufenparadigma sind hier unabdingbare Voraussetzungen, den »Typus« Verfassungsstaat rechts- wie kulturwissenschaftlich zu erschließen. Dazu gehört aber auch, daß die schöne Literatur und die anderen Künste wie die Musik mit einbezogen werden.
Den »Rahmen« für die Darstellung bilden die Präambeln, Übergangs- und Schlußbestimmungen. Das gesamte Werk stützt sich auf fast weltweiten, Kleinstaaten und Entwicklungsländer einbeziehenden Vergleich von Verfassungstexten als »Primärliteratur«, da in ihnen auch Wirklichkeit, Judikatur und Wissenschaft gespeichert ist und sich nur aus dieser ineinandergreifenden Vielfalt das »Weltbild des Verfassungsstaates« als Quintessenz erkennen läßt.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 1233
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 436
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783428092024
- Verschijningsdatum:
- 24/07/1998
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 155 mm x 231 mm
- Gewicht:
- 17408 g
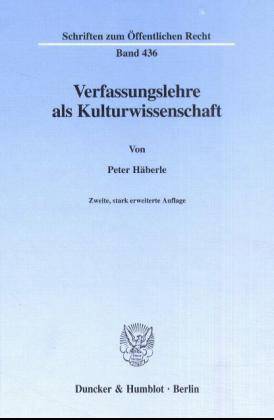
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 295 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.