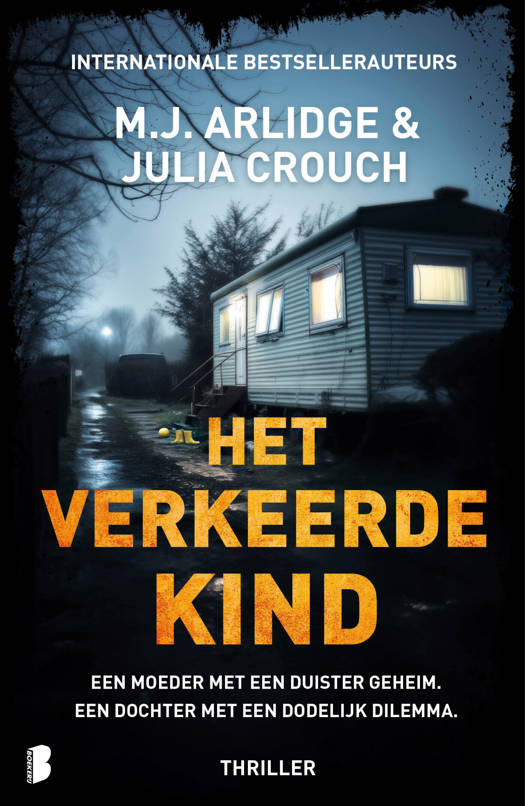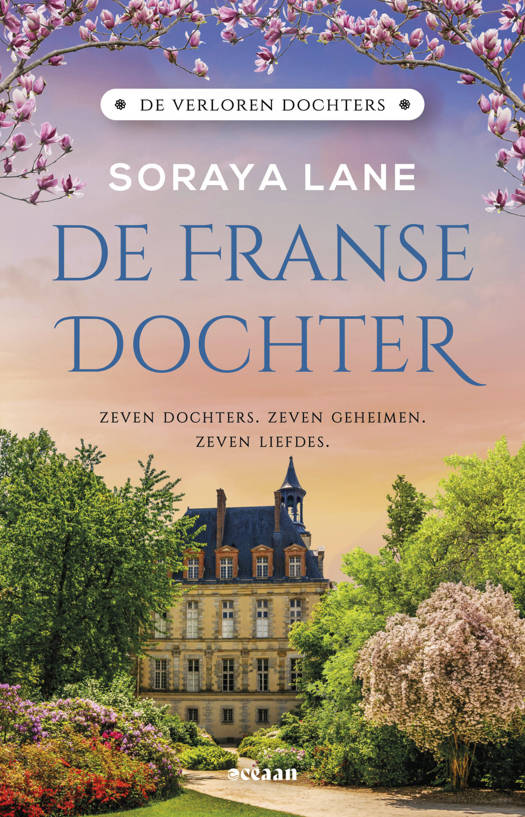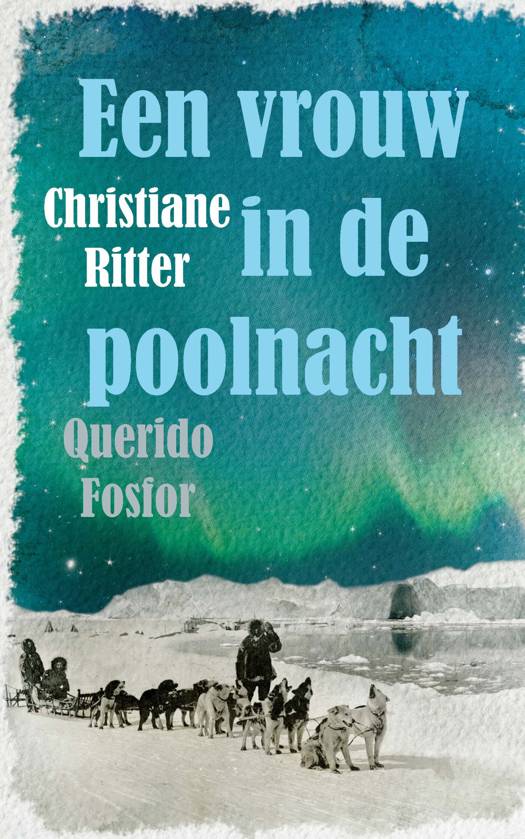
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Rechtsvielfalt vor Gericht
Rechtsanwendung und Partikularrecht im Alten Reich. Habil.-Schr. Univ. Frankfurt a. M. 2001
Peter Oestmann
€ 126,45
+ 252 punten
Omschrijving
Die Frage nach dem vor Gericht anwendbaren und angewendeten Recht gilt seit langem als ein zentrales Problem der frühneuzeitlichen Rechtsgeschichte. Nach verbreiteter Auffassung soll die Rezeption des römischen Rechts eine nachhaltige Zurückdrängung der einheimischen Rechtsgewohnheiten durch die mit gelehrten Juristen besetzten Gerichte bewirkt haben. Der Grund hierfür wird darin gesehen, dass zum einen eine Geltungsvermutung zugunsten des gelehrten römischen Rechts bestanden habe und außerdem die örtlichen Rechtsquellen wie beweisbedürftige Tatsachen behandelt worden seien.
Diese sog. Rechtsanwendungslehre wurde bisher nur anhand der zeitgenössischen juristischen Literatur rekonstruiert. Aussagen darüber, ob die Rechtspraxis den Maßgaben der wissenschaftlichen Literatur entsprach, besaßen daher keine Quellengrundlage. Die vorliegende Arbeit wertet Prozessakten des Reichskammergerichts aus und klärt auf diese Weise, wie sich das Rechtsanwendungsproblem in der frühen Neuzeit vor Gerich ten der ersten sowie der zweiten Instanz darstellte. Die Argumentation der Parteien, Einzelheiten der Beweisführungen sowie die Frage nach der Rechtsanwendung des Gerichts stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Mit Frankfurt am Main und Lübeck werden bewusst zwei Reichsstädte mit unterschiedlichen Rechtskulturen behandelt, die gerade im hier wichtigen Punkt, der Anlehnung an das gelehrte römisch-kanonische Recht, stark voneinander abweichen. Im Ergebnis zeigen sich Ansätze eines neuen Gesamtbildes, das auf der zeitgenössischen Rechtsvielfalt, der anwaltlichen Prozessführung unter Unsicherheitsbedingungen sowie der richterlichen Entscheidungsfreiheit und Begründungsvielfalt aufbaut.
Diese sog. Rechtsanwendungslehre wurde bisher nur anhand der zeitgenössischen juristischen Literatur rekonstruiert. Aussagen darüber, ob die Rechtspraxis den Maßgaben der wissenschaftlichen Literatur entsprach, besaßen daher keine Quellengrundlage. Die vorliegende Arbeit wertet Prozessakten des Reichskammergerichts aus und klärt auf diese Weise, wie sich das Rechtsanwendungsproblem in der frühen Neuzeit vor Gerich ten der ersten sowie der zweiten Instanz darstellte. Die Argumentation der Parteien, Einzelheiten der Beweisführungen sowie die Frage nach der Rechtsanwendung des Gerichts stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Mit Frankfurt am Main und Lübeck werden bewusst zwei Reichsstädte mit unterschiedlichen Rechtskulturen behandelt, die gerade im hier wichtigen Punkt, der Anlehnung an das gelehrte römisch-kanonische Recht, stark voneinander abweichen. Im Ergebnis zeigen sich Ansätze eines neuen Gesamtbildes, das auf der zeitgenössischen Rechtsvielfalt, der anwaltlichen Prozessführung unter Unsicherheitsbedingungen sowie der richterlichen Entscheidungsfreiheit und Begründungsvielfalt aufbaut.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 728
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 18
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783465032151
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Linnen over kaft
- Afmetingen:
- 174 mm x 249 mm
- Gewicht:
- 1128 g

Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 252 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.