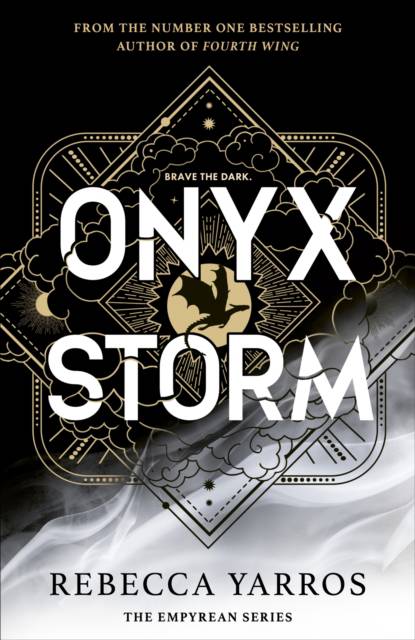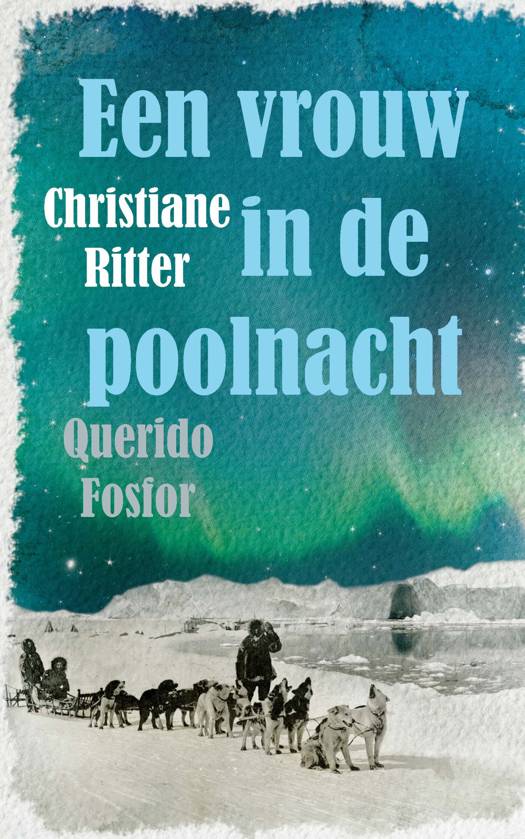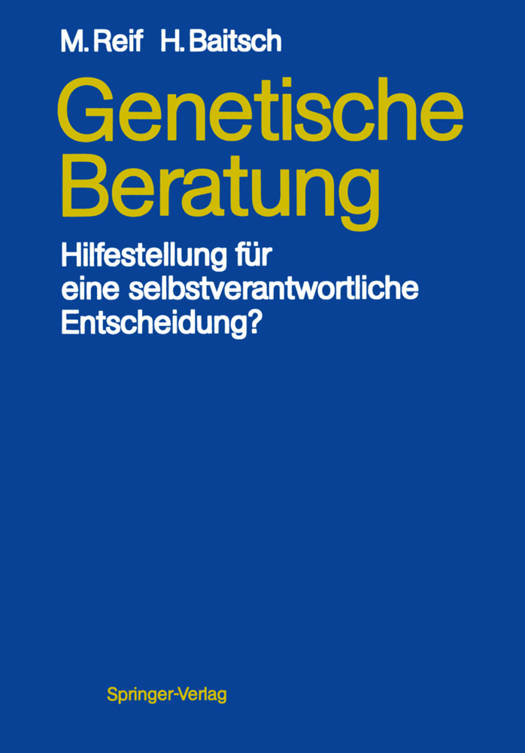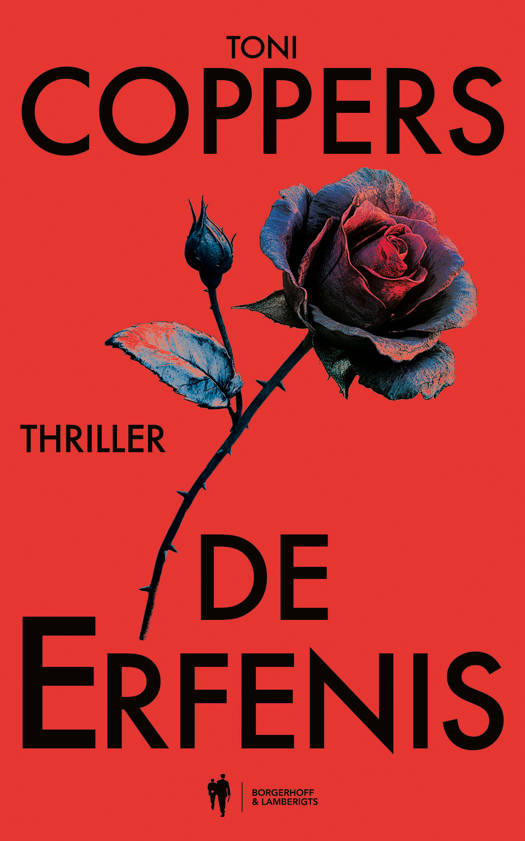
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Genetische Beratung
Hilfestellung Für Eine Selbstverantwortliche Entscheidung?
Maria Reif, Helmut Baitsch
Paperback | Duits
€ 54,45
+ 108 punten
Omschrijving
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Forschungspro- jekts, das wesentlich aus zwei biographischen Wurzeln erwuchs: Weit zurück reichen die Erfahrungen und Ideen von Helmut Baitsch, der sich bereits in den 50er Jahren mit der Geschichte und dem Selbstverständnis der Anthropologie und Humangenetik aus- einandersetzte. Diese Reflexionen über die historische Entwicklung des Fachgebietes, die Aufgaben, Ziele, Wertkonzepte und Auswir- kungen der Anthropologie und Humangenetik auf die Gesellschaft und insbesondere auf den einzelnen und seine Familie führten da- zu, die genetische Beratung als komplexen psychosozialen Prozeß zu verstehen. Ende der 70er Jahre konzipierte er das Projekt Ärztli- che und psychologische Aspekte der genetischen Beratung als ein Teil- projekt des Sonderforschungsbereiches 129 Psychotherapeutische Prozesse, dessen Sprecher er damals war. Maria Reif befaßte sich zunächst im Rahmen der Sozialisationsforschung mit Fragen der in- terpersonellen Wahrnehmung und des wechselseitigen Verständnis- ses. Hierbei ging es ihr insbesondere um die Fähigkeit des einzelnen zu erkennen, was und aus welchem Grund der jeweilige Interak- tionspartner in einer gegebenen Situation von ihm erwartet, um die Fähigkeit, dies mit den eigenen Bedürfnissen, Erwartungen und Wertorientierungen in Beziehung zu setzen, und - beides berück- sichtigend - handeln zu können. Die Komplexität, die Situations- spezifität und die Subjektivität des menschlichen Handelns sowie die Schwierigkeit, diese im Forschungsprozeß angemessen zu erfas- sen, stellten seit jeher einen besonderen Anreiz und damit Arbeits- schwerpunkt für sie dar. Dies führte zu einer ausführlichen Ausein- andersetzung mit Konzepten der Sozialisationstheorie, der Sozial- psychologie, der phänomenologisch orientierten . soziologie und schließlich der qualitativen Sozialforschung.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 247
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783540169581
- Verschijningsdatum:
- 1/12/1986
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 170 mm x 244 mm
- Gewicht:
- 426 g
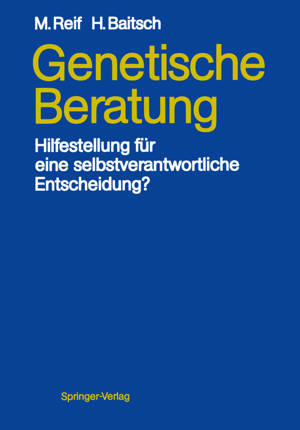
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 108 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.